DeepSeek verspricht eine leistungsstarke, kostengünstige Alternative zu ChatGPT und Co. Doch hinter der technologischen Innovation lauern offenbar erhebliche Risiken, weshalb gerade HR von einer Nutzung absehen sollte. „Es scheint bei DeepSeek datenschutzrechtlich an so ziemlich allem zu fehlen“, warnt beispielsweise der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann.
Die KI-Anwendung habe weder eine europäische Niederlassung noch einen gesetzlichen Vertreter in der EU – ein klarer Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Noch alarmierender sei, dass nicht transparent ist, welche Nutzerdaten DeepSeek erfasst und wie sie verarbeitet werden.
Auch im europäischen Ausland ist die KI bereits in Verruf geraten. So hat die niederländische Datenschutzbehörde AP bereits eine Untersuchung eingeleitet. Die Datenschützer raten Unternehmen dringend zur Vorsicht, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass personenbezogene Daten in einer Weise verarbeitet werden, die nicht mit der DSGVO konform ist. Auch in Italien wurde DeepSeek von der Datenschutzbehörde Garante gesperrt, nachdem das Unternehmen keine zufriedenstellenden Antworten zu seiner Datenverarbeitung liefern konnte.
Wer hat Zugriff auf die Daten?
Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass DeepSeek keine Klarheit darüber schafft, wo die erhobenen Daten tatsächlich landen. „Nutzer müssen sich darüber im Klaren sein, dass alle Daten, die mit der Plattform geteilt werden, gemäß den chinesischen Gesetzen zur Cybersicherheit, die vorschreiben, dass Unternehmen auf Anfrage von Behörden Zugang zu Daten gewähren müssen, dem Zugriff durch die Regierung unterliegen können“, warnt Adrianus Warmenhoven, Cybersicherheits-Experte beim Dienstleister NordVPN. Tatsächlich ist es in China gesetzlich vorgeschrieben, dass Technologieunternehmen auf Verlangen der Regierung Zugriff auf ihre gespeicherten Daten gewähren müssen.
Dass an DeepSeek nicht alles schlecht ist und zumindest theoretisch eine ernsthafte Alternative zu westlichen KI-Systemen sein könnte, unterstreicht Tech-Investor Marc Andreessen. DeepSeek sei „einer der erstaunlichsten und beeindruckendsten Durchbrüche“, die er je gesehen habe – und „als Open Source ein tiefgreifendes Geschenk an die Welt.“ Offenbar schlägt DeepSeek“ den bisher „intelligentesten“ Chatbot ChatGPT 01 (der nur zahlenden Kunden zur Verfügung steht) in diversen Benchmarks in gleich mehreren Disziplinen.
Während ChatGPT eher Alltagsfragen abdeckt, funktioniert DeepSeek nach eigener Aussage besonders gut bei solchen Anwendungen, in denen präzise Fachauskünfte gefragt sind. Dazu gehören zum Beispiel medizinische, juristische oder technische Themen, bei denen eine exakte und verlässliche Antwort wesentlich sein kann.
Zensur als fester Bestandteil der Technologie
Daniel Mühlbauer, Experte für People Technology bei der Siemens AG und HR-Influencer, sieht das Thema DeepSeek auf Anfrage unserer Redaktion gelassen, zumindest, was die Datensicherheit angeht. Den Zugriff von außerhalb könne man nämlich recht einfach umgehen: „Anders als bei den anderen Systemen kann man DeepSeek lokal aufsetzen und dann das Modell nutzen, ohne die Daten und Eingaben mit den Machern zu teilen“, so Mühlbauer. Von der Nutzung der in China gehosteten Version rät aber auch er ab. „Als App auf dem Handy habe ich es nicht“, sagt der Experte mit einem Augenzwinkern.
Die Zensur von unliebsamen Inhalten sollte westliche Nutzerinnen und Nutzer zumindest aufhorchen lassen. Während westliche KI-Systeme wie ChatGPT oder Google Gemini aufgrund ethischer Prinzipien bestimmte Inhalte einschränken, unterliegt DeepSeek klarer staatlicher Kontrolle. Der WDR-Digitalexperte Jörg Schieb stellt klar: „DeepSeek ist ein Paradebeispiel dafür, wie KI in China funktioniert: Hochentwickelt, aber strikt zensiert.“
Info
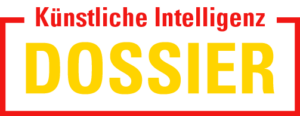
Dann schauen Sie doch einmal in unser Dossier zum Thema. Dort stellen wir für Sie kontinuierlich aktuelle Berichte, Analysen, Deep-Dives und Tools für den Einsatz von KI im HR-Alltag zusammen.
Bei Fragen zu heiklen politischen Themen – etwa den Protesten auf dem Tiananmen-Platz 1989 – verweigert DeepSeek schlichtweg die Antwort. Der Standardtext: „Sorry, that’s beyond my current scope. Let’s talk about something else.“ Auffällig ist, dass die KI die Fakten durchaus zu kennen scheint, diese aber nach wenigen Sekunden durch eine Zensurtechnologie gelöscht werden. Daniel Mühlbauer mutmaßt indes, dass auch bei US-amerikanischen Modellen künftig mehr zensiert wird: „Die Zensur historischer Fakten wie im Fall des Tiananmen-Platzes ist natürlich Müll. Leider wird man diese Zensur jetzt auch bei Modellen aus Trumps Amerika sehen, vermute ich.“
Keine echte KI-Alternative
DeepSeek mag auf den ersten Blick eine vielversprechende Alternative zu etablierten KI-Systemen sein – doch die Risiken überwiegen. Datenschutzverletzungen, unklare Datenflüsse und politische Einflussnahme machen die Anwendung für deutsche Unternehmen problematisch. Anwalt und IT-Rechtler Wolfgang Herfurther rät: „Die Entwicklung der rechtlichen Situation rund um DeepSeek bleibt abzuwarten. Unternehmen und Kommunen sollten daher regelmäßig prüfen, ob neue rechtliche Einschätzungen oder Vorgaben zu beachten sind.“
So oder so: Die Nutzung von DeepSeek ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, sodass Unternehmen eher auf KI-Lösungen setzen sollten, die europäischen Datenschutzstandards entsprechen. Oder, wie Dieter Kugelmann es formuliert: „Wer DeepSeek in einem deutschen Unternehmen einsetzt, holt sich eine tickende Zeitbombe ins Haus.“
Sven Frost betreut das Thema HR-Tech, zu dem unter anderem die Bereiche Digitalisierung, HR-Software, Zeit und Zutritt, SAP und Outsourcing gehören. Zudem schreibt er über Arbeitsrecht und Regulatorik und verantwortet die redaktionelle Planung verschiedener Sonderpublikationen der Personalwirtschaft.


